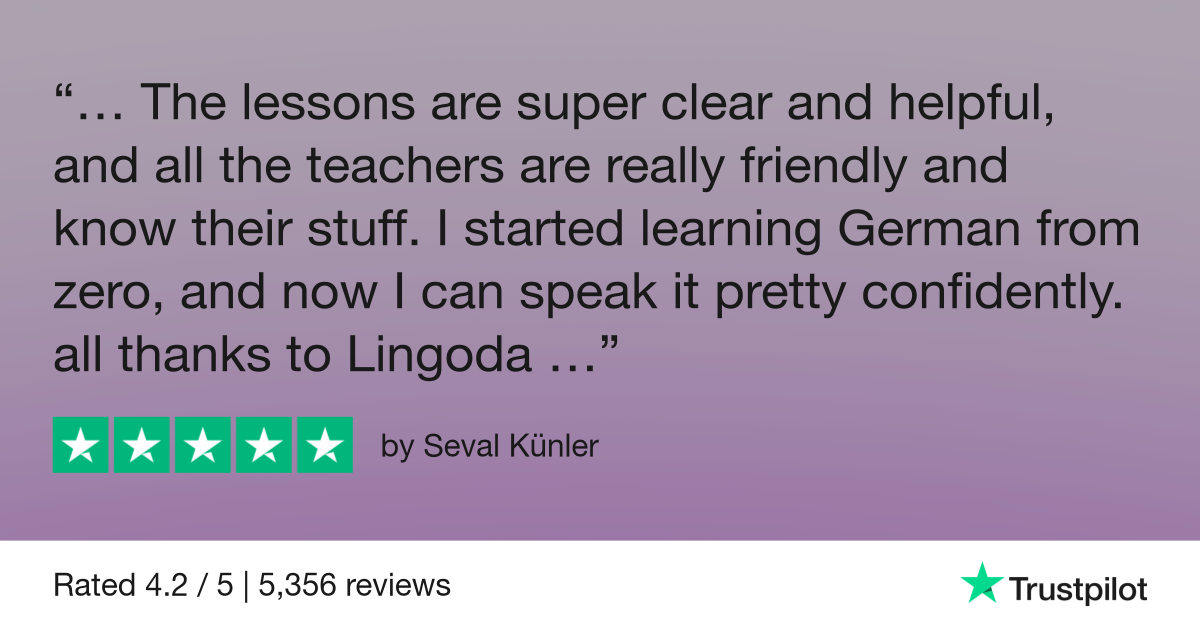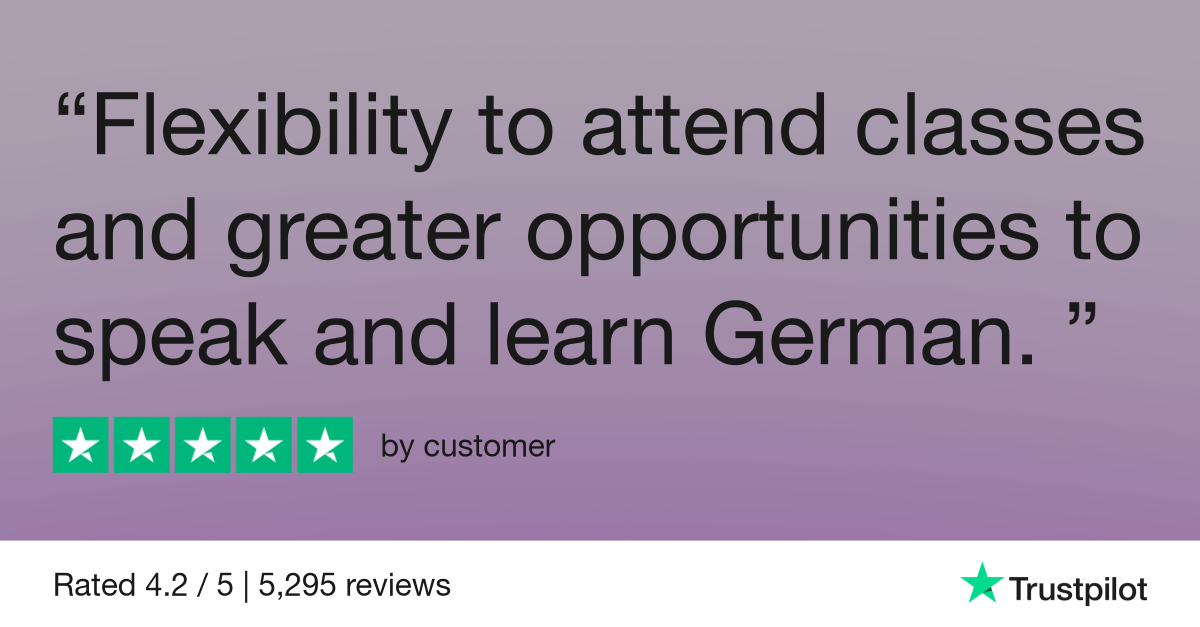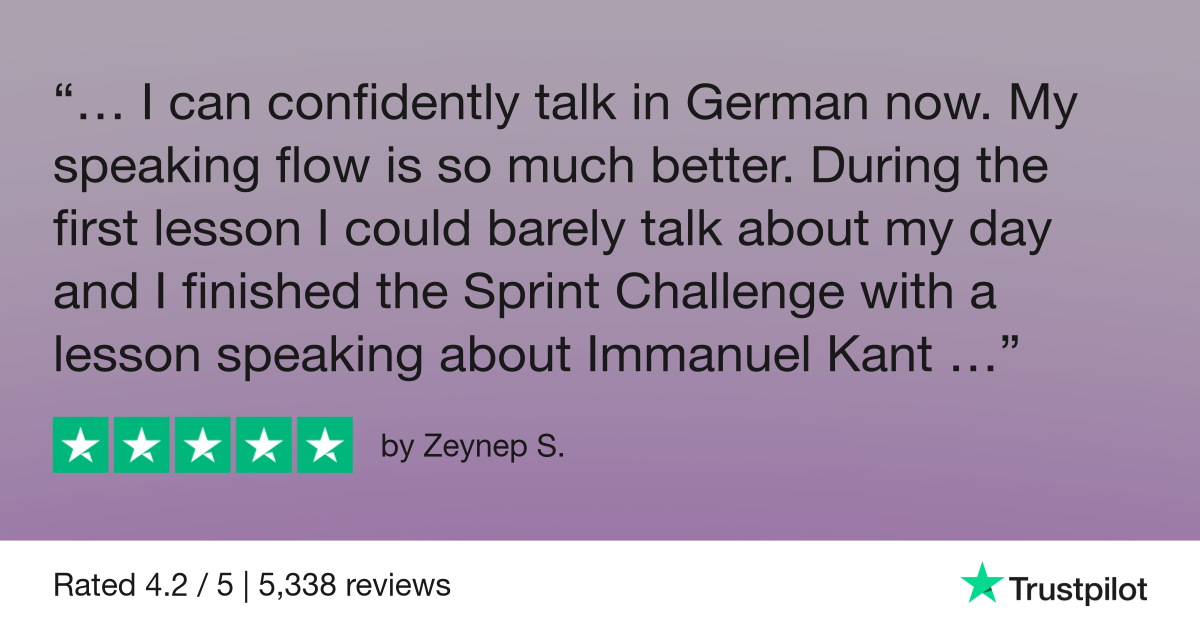Relativsätze im Deutschen verstehen und anwenden

Wenn du dich schon länger fragst, was es mit dem Relativsatz auf Deutsch auf sich hat, bist du hier genau richtig. Diese besondere Kategorie der Nebensätze ist besonders praktisch: Sie hilft dir dabei, mehrere Informationen zu einem Nomen in nur einem Satz unterzubringen. Mit Relativpronomen wie “der”, “die” oder “das”, gelingt es, Informationen präziser zu verbinden und Texte oder Gespräche flüssiger zu gestalten.
Wie das genau aussieht und was du bei der Bildung von Relativsätzen auf Deutsch beachten solltest, erfährst du hier. Wir erklären den Aufbau, und die Stellung der einzelnen Satzglieder und betrachten obendrein Relativsätze mit Präpositionen und Relativadverbien.
- Relativsätze einfach erklärt: Bedeutung und Einsatz im Alltag
- Aufbau und Stellung eines Relativsatzes im Satz
- Relativsatz und Kasus – wie der Kasus im Relativsatz funktioniert
- Relativsätze mit Präpositionen
- Relativsätze mit Relativadverbien
- Mehrteilig verschachtelte Relativsätze verstehen
Relativsätze einfach erklärt: Bedeutung und Einsatz im Alltag
Was ist ein Relativsatz?
Bereits viele einfache deutsche Sätze bestehen aus mehreren Teilen, die mit einem Komma voneinander abgetrennt sind. Man unterscheidet dabei zwischen Hauptsätzen und Nebensätzen. Während Hauptsätze auch für sich stehen können, tritt der Nebensatz nur in Kombination mit einem Hauptsatz auf.
Eine spezielle Form der Nebensätze sind Relativsätze. Du brauchst sie im Deutschen, wenn du zusätzliche Informationen über ein Nomen oder ein Pronomen geben willst, ohne dafür einen neuen Satz anzufangen.
H3: Warum und wie man Relativsätze im Alltag verwendet
Der Relativsatz auf Deutsch ist sowohl in der gesprochenen als auch der geschriebenen Sprache sehr nützlich. Er hilft dir dabei, flüssiger und ohne unnötige Pausen mehrere Informationen über ein Pronomen in einem Satz zu vereinen.
Im folgenden Beispiel siehst du, wie praktisch Relativsätze sind::
Aussage in zwei Hauptsätzen:
Ich kenne meine Freunde schon sehr lange. Meine Freunde kommen mich besuchen.
Gleiche Aussage mit Hauptsatz und Relativsatz:
Meine Freunde, die ich schon sehr lange kenne, kommen mich besuchen.
Die zweite Version wirkt nicht nur eleganter, sie spart dir außerdem Zeit. Anstatt eine Pause zwischen zwei Sätzen einzulegen und das Nomen (meine Freunde) zu wiederholen, verpackst du mit dem Relativsatz alles praktisch in einen Satz.

Lerne Deutsch mit Lingoda
So funktioniert's

Aufbau und Stellung eines Relativsatzes im Satz
Da der Relativsatz nähere Informationen zu einem Nomen oder Pronomen im Hauptsatz gibt, steht er stets nach dem Nomen, auf das er sich bezieht. Du findest ihn entweder zwischen Hauptsatzteilen oder am Ende eines Satzes, je nachdem, wo das Bezugswort steht.
Diese zwei Möglichkeiten der Relativsatzstellung gibt es:
Relativsatz am Ende des Satzes: Ich kenne den Mann, der im Supermarkt arbeitet.
Relativsatz in der Mitte des Satzes: Den Mann, der im Supermarkt arbeitet, kenne ich.
Egal, wo der Relativsatz steht, das Verb des Relativsatzes steht immer am Ende (in diesem Fall “arbeitet”). Damit der Relativsatz leichter zu erkennen ist, wird er vom Hauptsatz mit einem Komma abgetrennt. Er beginnt meistens mit einem Relativpronomen wie “der”, “die”, “das”, “welcher”, “welche”, “welches”.
Relativsatz und Kasus – wie der Kasus im Relativsatz funktioniert
Das Relativpronomen in einem Relativsatz kann in allen vier deutschen Fällen vorkommen: dem Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Je nachdem, welche Funktion ein Relativsatz übernimmt, verändert sich der Kasus oder Fall des Relativpronomens.
Wie auch bei Hauptsätzen ist es bei der Identifizierung des richtigen Falls wichtig, die passenden Fragewörter zu kennen:
Nominativ: Wer oder was?
Dativ: Wem oder was?
Akkusativ: Wen oder was?
Genitiv: Wessen?
| Kasus | Beispiel | Funktion des Relativpronomens |
| Nominativ | Der Mann, der hier wohnt, ist mein Nachbar. | „der“ ist Subjekt im Relativsatz. Frage: Wer oder was wohnt hier? |
| Akkusativ | Die Frau, die ich gesehen habe, heißt Anna. | „die“ ist direktes Objekt im Relativsatz Frage: Wen oder was habe ich gesehen? |
| Dativ | Das Kind, dem ich geholfen habe, ist krank. | „dem“ ist indirektes Objekt im Relativsatz Frage: Wem oder was habe ich geholfen? |
| Genitiv | Der Mann, dessen Auto kaputt ist, wohnt hier. | „dessen“ zeigt Besitz an und weißt auf den Genitiv hin Frage: Wessen Auto ist kaputt? |
Besonders wichtig ist es, die Frage nach dem Kasus im Relativsatz zu stellen, nicht im Hauptsatz. Auf diese Weise findest du heraus, welche Form des Relativpronomens passend ist. Das Nomen des Hauptsatzes kann durchaus in einem anderen Kasus stehen.
Relativsätze mit Präpositionen
Präpositionen sind Wörter, die Beziehungen zwischen Wörtern oder Satzteilen ausdrücken. Sie zeigen zum Beispiel an, wo etwas ist (Ort), wann etwas passiert (Zeit) oder in welchem Zusammenhang etwas steht. Beispiele für Präpositionen sind: in, auf, unter, neben, nach, vor, zu, wegen, trotz.
Auch in einigen Relativsätzen kommen Präpositionen vor, wenn das Verb des Relativsatzes nach einer Präposition verlangt. Zu diesen speziellen Verben zählen zum Beispiel “warten auf”, “rechnen mit” oder “erinnern an”. Am besten lernst du die Präposition bei Verben immer gleich mit, wenn du neue Vokabeln lernst. So weißt du gleich, wie du sie einsetzen musst.
Im Relativsatz sieht das so aus:
Die Frau, für die ich arbeite, ist sehr nett.
Das Buch, an dem er schreibt, erscheint bald.
Wie in diesen Beispielen erkennbar ist, steht die Präposition im Relativsatz immer vor dem Relativpronomen.
Relativsätze mit Relativadverbien
Relativsätze können nicht nur mit Relativpronomen, sondern auch mit Relativadverbien eingeleitet werden. Relativadverbien nutzt du immer dann, wenn du dich auf einen Ort, eine Zeit oder einen Grund beziehst. Relativadverbien ersetzen kein Nomen, sondern beziehen sich auf Umstände wie Ort, Zeit oder Grund.
Wichtige Relativadverbien:
- wo → für Orte
Beispiel: Das Café, wo wir uns getroffen haben, war schön. - wann → für Zeiten
Beispiel: Der Tag, an dem ich angekommen bin, war regnerisch. - warum → für Gründe
Beispiel: Das ist der Grund, warum ich gehe.
Mehrteilig verschachtelte Relativsätze verstehen
Deutsch ist bekannt für lange, zusammengesetzte Nomen und lange Sätze. Auch Relativsätze können mehrfach verschachtelt sein. Hier ein Beispiel mit zwei Relativsätzen:
Ich möchte den Anzug anprobieren, den ich in dem Geschäft gesehen habe, das gegenüber vom Hotel ist.
In diesem Satz erhältst du mehrere Informationen über den Anzug aus dem Hauptsatz:
1. Die Person hat ihn in einem Geschäft gesehen
2. Das Geschäft war gegenüber vom Hotel.
Was sehr kompliziert wirkt, wird um einiges lesbarer, wenn du es dir in kleinere Happen aufteilst. Die Kommas helfen dir dabei, zu erkennen, wo ein Relativsatz anfängt und der andere endet. Teile dir den Satz also am besten in kleinere Stücke auf, um all die Information zu erfassen, die enthalten ist.
Wie kann ich einen Relativsatz erkennen?
Du kannst einen Relativsatz daran erkennen, dass er mit einem Relativpronomen wie „der“, „die“, „das“, „welcher“ oder einem Relativadverb wie „wo“, „wann“ beginnt. Er steht immer in Beziehung zu einem Nomen im Hauptsatz und ist durch ein Komma abgetrennt. Am Ende eines Relativsatzes steht immer das konjugierte Verb.
Wie bilde ich Relativsätze?
Um einen Relativsatz zu bilden, brauchst du zuerst ein Nomen im Hauptsatz, auf das du dich beziehen möchtest. Danach fügst du das passende Relativpronomen oder Relativadverb ein und bildest einen Nebensatz, bei dem das Verb am Ende steht. Zum Beispiel: „Das ist die Frau, die nebenan wohnt.”
Fazit – Mit Relativsätzen zum natürlicheren Deutsch
Mit Relativsätzen gelingt es dir, elegant mehrere Informationen zu einem Nomen in einen Satz zu packen. Dein Deutsch klingt dadurch weniger abgehakt. Obendrein sparen dir Relativsätze Zeit. Statt zu sagen, “Das ist meine Schwester. Meine Schwester wohnt weit weg.”, kannst du diesen Satz mit der Hilfe eines Relativpronomens wie “der”, “die”, “das” oder “welcher”, “welche”, “welches” verkürzen: “Das ist meine Schwester, die weit weg wohnt.”
Auch Verbindungen mit Relativadverbien sind möglich, wenn du dich auf einen Ort, Zeit oder Grund beziehen möchtest.
Es kann herausfordernd sein, vor allem verschachtelte Relativsätze zu meistern. Falls du dir dabei Unterstützung wünschst, kannst du in einem Deutschkurs bei Lingoda von Lehrkräften auf muttersprachlichem Niveau lernen, die dir genau erklären, wie Relativsätze im Alltag klingen und funktionieren.

Lerne Deutsch mit Lingoda
So funktioniert's