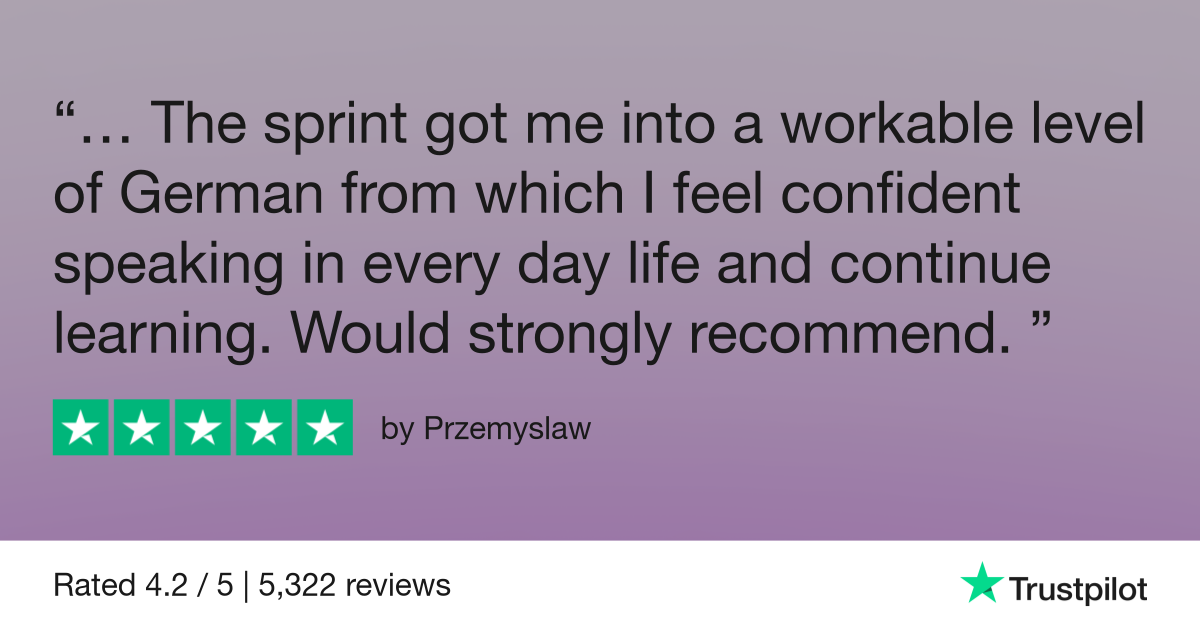Passiv auf Deutsch: Eine Anleitung für Deutschlernende

Früher oder später begegnet allen Deutschlernenden das Passiv. Es handelt sich dabei um eine besondere Form, mit der Handlungen beschrieben werden, ohne dass die handelnde Person im Mittelpunkt steht. Der Fokus liegt hier auf dem Geschehen und nicht auf der ausführenden Person. Das macht Passivsätze besonders nützlich, wenn du nicht weißt, wer handelt oder es für die Aussage nicht relevant ist.
In diesem Artikel erfährst du, wie du das Passiv und seine verschiedenen Formen bildest. Mit vielen Anwendungsbeispielen lernst du, das Passiv auf Deutsch souverän und sinnvoll einzusetzen.
- Was ist das Passiv im Deutschen?
- Bildung von Passivsätzen
- Verwendung von Passiv im Alltag
- Passiv mit Modalverben
- Welche Verben können kein Passiv bilden?
- Das Passiv in gesprochenem Deutsch – klingt das überhaupt natürlich?
Was ist das Passiv im Deutschen?
Verben können in deutschen Sätzen sowohl in der passiven Form als auch in der aktiven Form stehen. Das Passiv lässt sich am leichtesten erklären, indem man den Unterschied zum Aktiv betrachtet:
Passiv: Der Kuchen wird gebacken.
Aktiv: Der Mann backt einen Kuchen.
Während im Passiv die Handlung, also das Kuchenbacken, betont wird und nicht erkenntlich ist, wer oder was den Kuchen backt, wird im Aktiv die ausführende Person hervorgehoben.
Im Aktivsatz erfahren wir, wer das ausführende Subjekt ist (in diesem Beispiel der Mann). Der Passivsatz lässt die handelnde Person in unserem Beispiel sogar ganz außen vor und legt den Fokus auf die Handlung oder Zustand und das Objekt des Satzes: den Kuchen.
Im Passiv steht also das Objekt oder die Handlung im Vordergrund. In Aktivsätzen liegt der Fokus auf dem Subjekt, das eine Handlung ausführt.
Wir brauchen das Passiv im Deutschen vor allem in Situationen, in denen es nicht notwendig ist, das Subjekt zu nennen oder es unbekannt ist. Sätze können dadurch verkürzt und vereinfacht werden.

Lerne Deutsch mit Lingoda
So funktioniert's

Bildung von Passivsätzen
Es gibt verschiedene Arten, Passivsätze zu bilden. Man unterscheidet dabei zwischen zwei Formen: dem Vorgangspassiv und dem Zustandspassiv. Wie ihre Namen bereits verraten, werden diese zwei Passivformen für unterschiedliche Fälle verwendet.
Das Vorgangspassiv
Beim Vorgangspassiv geht es um Handlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, sondern noch ausgeführt werden. Du bildest es mit der Kombination werden + Partizip II.
Beispiele für das Vorgangspassiv:
Die Tür wird geöffnet.
Das Essen wurde bestellt.
Die Frau ist angerufen worden.
Du kannst das Vorgangspassiv in allen deutschen Zeitformen verwenden. Dabei musst du nur das Verb “werden” verändern und mit dem Partizip II des Verbs kombinieren, das den Vorgang beschreibt.
| Tempus | Beispielsatz |
| Präsens | Der Brief wird geschrieben. |
| Präteritum | Der Brief wurde geschrieben. |
| Perfekt | Der Brief ist geschrieben worden. |
| Plusquamperfekt | Der Brief war geschrieben worden. |
| Futur I | Der Brief wird geschrieben werden. |
| Futur II | Der Brief wird geschrieben worden sein. |
Das Zustandspassiv
Beim Zustandspassiv geht es um Handlungen, die abgeschlossen sind und zu einem Zustand entwickelt haben. Das Zustandspassiv bildest du mit der Kombination aus sein + Partizip II.
Beispiel für das Zustandspassiv:
Die Tür ist geöffnet.
Das Essen ist bestellt worden.
Die Frau ist angerufen worden.
Das Zustandspassiv kannst du nicht mit allen Zeitformen bilden. Diese Form existiert nur im Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt und Futur I.
| Tempus | Beispielsatz |
| Präsens | Der Brief ist geschrieben. |
| Präteritum | Der Brief war geschrieben. |
| Plusquamperfekt | Der Brief war geschrieben gewesen. |
| Futur I | Der Brief wird geschrieben sein. |
Im Perfekt und Futur II wäre die Bildung des Zustandspassiv sehr umständlich, weswegen es im Sprachgebrauch nicht verwendet wird.
Verwendung von Passiv im Alltag
Da du jetzt weißt, wie das Passiv im Deutschen gebildet wird, stellt sich die Frage: Wird das Passiv im Alltag wirklich verwendet? Auch, wenn es vor allem im gesprochenen Alltagsdeutsch seltener zur Anwendung kommt als die aktive Form, ist das Passiv wichtig und notwendig.
Immer dann, wenn der Fokus auf der Handlung und weniger auf der ausführenden Instanz liegt, lässt sich das durch die Verwendung des Passivs klarer ausdrücken als mit Aktivsätzen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn nicht klar ist, wer handelt. Man hört Passiv-Formulierungen daher häufig in formelleren Texten wie in den Nachrichten:
Die Ergebnisse der Wahl wurden ausgewertet.
Der Vorfall wird nun genauer untersucht.
Vor allem für wissenschaftlichen Arbeiten, die viel Wert auf Allgemeingültigkeit legen, sind Passivsätze relevant, weil du damit die Ich-Form oder Sätze mit man vermeiden kannst. Anstatt zu sagen, “Ich bin der Meinung, dass Mozart einer der besten Komponisten aller Zeiten war.”, kannst du den Satz auf die folgende Weise formulieren:
Es wird von vielen die Meinung vertreten, dass Mozart einer der besten Komponisten aller Zeiten war.
Das Passiv klingt hier professioneller und distanzierter. Zudem erhältst du durch die Anwendung die Chance, mehrere Menschen in die Aussage mit einzubeziehen und anschließend mit Namen zu nennen, wenn du die Aussage unterstreichen möchtest.
Passiv mit Modalverben
In manchen Situationen bildest du die Passivkonstruktionen im Deutschen zusammen mit Modalverben. Modalverben sind Verben, die andere Verben in ihrer Aussageabsicht verändern oder ergänzen. Dazu zählen zum Beispiel müssen, können, dürfen oder sollen.
Die Bildung der Struktur gelingt dir, indem du die folgende Struktur verwendest:
Modalverb + Partizip II + werden
Beispiele für die Passivstruktur mit Modalverben:
Das Auto muss repariert werden.
Die Rechnung soll bezahlt werden.
Der Brief darf nicht geöffnet werden.
Die Fenster können geschlossen werden.
Diese Struktur kannst du theoretisch in allen Zeitformen bilden. Allerdings sind, wie auch beim Zustandspassiv, ein paar davon sehr kompliziert zu bilden und daher weniger üblich. Während Präsens, Präteritum und Futur I auch im täglichen Sprachgebrauch vorkommen, wirst du das Perfekt, Plusquamperfekt oder Futur II der Passivstruktur mit Modalverb so gut wie nie hören.
In der Tabelle siehst du, wie die Bildung der verschiedenen Zeitformen funktioniert:
| Tempus | Beispiel |
| Präsens | Das Auto muss repariert werden. |
| Präteritum | Das Auto musste repariert werden. |
| Perfekt | Das Auto hat repariert werden müssen. |
| Plusquamperfekt | Das Auto hatte repariert werden müssen. |
| Futur I | Das Auto wird repariert werden müssen. |
| Futur II | Das Auto wird repariert worden sein müssen. |
Welche Verben können kein Passiv bilden?
Obwohl die Bildung von Passivsätzen mit den meisten Verben möglich ist, gibt es ein paar Ausnahmen. Du kannst das Passiv zum Beispiel nicht mit Verben bilden, die kein Akkusativobjekt haben. Das liegt daran, dass nur das Akkusativobjekt in einem Aktivsatz zum Subjekt eines Passivsatzes werden kann.
Nehmen wir diesen Aktivsatz mit Akkusativobjekt:
Er fährt das Auto.
Im Passiv wird das Akkusativobjekt (das Auto) zum Subjekt:
Das Auto wird gefahren.
Sogenannte Intransitive Verben wie zum Beispiel schlafen, existieren oder reisen lassen jedoch kein Akkusativobjekt zu.
Beispielsatz mit intransitiven Verb:
Er schläft tief.
Würden wir daraus einen Passivsatz bilden wollen, wäre es nicht möglich, da die Bedeutung verloren geht:
Schlafen wird tief.
Das Gleiche gilt für reflexive Verben wie sich freuen oder sich vorbereiten:
Sie freuen sich auf den Feierabend.
Im Passiv ist die Bildung nicht möglich:
Der Feierabend wird sich gefreut.
Ebenfalls nicht möglich ist die Passivform von Konstruktionen, die ohnehin unpersönlich sind, also keinen Fokus auf die handelnde Person oder Sache legen. Dazu gehören zum Beispiel Aussagen wie: Es regnet.
Frage dich vor der Bildung des Passivs am besten, ob es im Kontext Sinn ergibt. Die Distanz, die durch die Verwendung des Passivs entsteht, ist bei manchen deutschen Sätzen (wie den oben genannten Beispielen) nicht sinnvoll.
Das Passiv in gesprochenem Deutsch – klingt das überhaupt natürlich?
Auch, wenn das Aktiv wesentlich häufiger verwendet wird, kommt auch die passive Form in gesprochenem Deutsch vor. Dabei klingt es nicht etwa gestelzt oder unnatürlich, sondern sogar sehr organisch, wenn du weißt, wann du es verwendest. Besonders gut funktionieren Passiv-Formulierungen, wenn sie kurz und knackig gehalten werden. Komplizierte Konstruktionen (siehe Perfekt oder Plusquamperfekt) solltest du beim Sprechen vermeiden.
Oft kommt es auch auf den Kontext an, ob das Passiv passt oder nicht. Die Frage “Ist der Hund gefüttert worden?” klingt zum Beispiel sehr natürlich, wenn man nicht weiß, wer den Hund heute gefüttert hat. Richtet sich die Frage an eine bestimmte Person, sollte aber das Aktiv verwendet werden (“Hast du den Hund heute gefüttert?”).
Eine beliebte Passiv-Formulierung, die zum Beispiel im Radio oder Podcasts häufig verwendet wird, ist das Gehören-Passiv. Ein Beispiel wäre, “Dieses Buch gehört gelesen.”. Obwohl das grammatikalisch nicht korrekt ist, hat sich die Phrase durchgesetzt und wird als literarisch wahrgenommen.
Auch das sogenannte Adressatenpassiv, der mit bekommen und dem Partizip II gebildet wird, hört man häufiger in gesprochenem Deutsch. Hier ist nicht der Handelnde wichtig, sondern die betroffene oder empfangende Person. Ein Beispiel wäre “Ich bekomme ein Buch geschenkt.” oder “Sie bekommt ein Rezept ausgestellt.”.
Im gesprochenen Deutsch wird das Passiv sparsam, aber gezielt verwendet, zum Beispiel dann, wenn der/die Handelnde nicht im Fokus steht oder man neutral klingen möchte.
Für den Alltag ist das Präsens und Präteritum des Vorgangspassivs am gebräuchlichsten.
Wie wird das Passiv im Deutschen gebildet?
Das Passiv im Deutschen wird mit dem Hilfsverb „werden“ und dem Partizip II des Vollverbs gebildet. Für das Zustandspassiv verwendet man stattdessen das Hilfsverb „sein“.
Welche Passivformen gibt es im Deutschen?
Im Deutschen gibt es zwei Hauptformen des Passivs: das Vorgangspassiv und das Zustandspassiv. Das Vorgangspassiv wird mit „werden + Partizip II“ gebildet und beschreibt einen Prozess oder eine Handlung. Das Zustandspassiv verwendet „sein + Partizip II“ und beschreibt das Ergebnis oder den Zustand nach einer Handlung.
Was du über das Passiv wissen musst
Das Passiv wird vor allem dann verwendet, wenn du Handlungen betonen oder unpersönlich und sachlich formulieren möchtest. Es gibt zwei Hauptformen: das Vorgangspassiv, das einen Prozess beschreibt, und das Zustandspassiv, das den daraus entstandenen Zustand betont. Auch Kombinationen mit Modalverben oder das Adressatenpassiv sind möglich.
Damit du sicher im Umgang mit Passivsätzen wirst, lohnt es sich, gezielt zu üben und viel aktiv zu sprechen. Mit dem Deutschkurs von Lingoda lernst du mit zertifizierten Lehrkräften auf muttersprachlichem Niveau ganz flexibel und rund um die Uhr, in kleinen Gruppen oder im Einzelunterricht.

Lerne Deutsch mit Lingoda
So funktioniert's